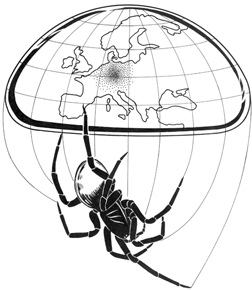Ein Beitrag zur Springspinnenfauna (Araneae: Salticidae) der Kanarischen Inseln mit der Erstbeschreibung von Euophrys arnograbollei spec. nov.
Contribution to the jumping spider fauna (Araneae: Salticidae) of the Canary Islands, with the first description of Euophrys arnograbollei spec. nov.
Canary Islands, distribution, new faunistic record, spiders
Abstract
During several trips to the Canary Islands, 23 species of jumping spiders in 14 genera were recorded. One of the species, Euophrys arnograbollei spec. nov., is described as new. Three other species, Menemerus fagei Berland & Millot, 1941, Pellenes arciger (Walckenaer, 1837) and Phlegra lineata (C. L. Koch, 1846) are recorded for the Canaries for the first time. For another eight salticid species first records are provided for islands on which they had not been recorded previously. In addition, the male and female of Euophrys canariensis Denis, 1941 are redescribed in detail in the context of the new description of Euophrys arnograbollei spec. nov. The status of Evarcha eriki Wunderlich, 1987 as a valid species is re-established.
Während mehrerer Reisen auf die Kanarischen Inseln wurden 23 Springspinnenarten aus 14 Gattungen nachgewiesen. Eine der Arten, Euophrys arnograbollei spec. nov., wird neu beschrieben. Drei weitere Arten, Menemerus fagei Berland & Millot, 1941, Pellenes arciger (Walckenaer, 1837) und Phlegra lineata (C. L. Koch, 1846) konnten erstmalig für die Kanaren nachgewiesen werden. Für acht weitere Salticidae werden Nachweise von Kanaren-Inseln angegeben, auf denen sie bisher noch nicht nachgewiesen wurden. Darüber hinaus erfolgt für Euophrys canariensis Denis, 1941 im Rahmen der Neubeschreibung von Euophrys arnograbollei spec. nov. eine detaillierte Beschreibung beider Geschlechter. Der Status von Evarcha eriki Wunderlich, 1987 als Art wird wiederhergestellt.
First records of Anagraphis ochracea (Araneae, Gnaphosidae) for continental Italy and Sicily with new observations on its myrmecophilous lifestyle
Erster Nachweis von Anagraphis ochracea (Araneae, Gnaphosidae) für das italienische Festland und Sizilien, mit neuen Beobachtungen zum myrmekophilen Lebensstil der Art
ant, ant association, Arachnida, Messor ibericus, myrmecophily, spider, symbiosis
Abstract
In the present study we describe and discuss for the first time the peculiar myrmecophilous habits of Anagraphis ochracea (L. Koch, 1867) and its strong association with the ant species Messor ibericus Santschi, 1931. The study is based on behavioural observations carried out both in the field and in captivity, and sheds light on the lifestyle of this poorly studied and rarely observed species. We also record the presence of A. ochracea on continental Italy and Sicily for the first time, provide a brief overview of its taxonomic history and present photographs of adult and juvenile specimens, the egg sac and the copulatory organs of both sexes. Finally, we provide a DNA-barcode (COI) for A. ochracea, which is the first for the genus Anagraphis as well.
In der vorliegenden Studie wird zum ersten Mal das besondere myrmekophile Verhalten von Anagraphis ochracea (L. Koch, 1867) und ihre enge Bindung an die Ameisenart Messor ibericus Santschi, 1931 beschrieben und diskutiert. Die Studie basiert auf Beobachtungen zum Verhalten im natürlichen Lebensraum wie auch im Labor und gibt Aufschluss über die Lebensweise dieser wenig erforschten und selten gefundenen Art. Ebenso wird der Erstnachweis von A. ochracea für das italienische Festland und Sizilien erbracht, sowie eine Zusammenfassung der taxonomischen Historie, Bilder adulter wie auch juveniler Tiere, der Kopulationsorgane beider Geschlechter und des Eikokons präsentiert. Zusätzlich wird erstmals der genetische Barcode (COI) der Art, und auch der Gattung Anagraphis, beschrieben.
Spiders (Araneae) from green roofs in north-west Switzerland – faunistic data with two species new to Switzerland
Spinnen (Araneae) von begrünten Dächern der Nordwestschweiz – faunistische Angaben mit zwei Erstnachweisen für die Schweiz
endangered species, faunistics, green roofs, neobionts, urban ecology
Abstract
Extensive green roofs are recognised as being a suitable habitat for some specific plants and arthropods that are resistant to very extreme hot and dry conditions. Little is known about spider species visiting and living on green roofs. In 2018 and 2019, 29 green roofs in Basel and four roofs in Aarau (Switzerland) were sampled using pitfall traps during the entire growing season. In the sampling period, 18492 adult spiders were collected and identified into 123 species. Two species were collected for the first time in Switzerland: Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 and Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837). According to the Red List of Germany (and especially Baden-Württemberg), 26 species are of special interest from a nature conservation perspective. On the other hand, four species are alien species (i.e. they originate from other continents), and 14 species are expanding their range northward. Green roofs may therefore harbour endangered species, but there is also the possibility that the newly invading species may become dominant. Only after many years or even decades will it be possible to judge whether green roofs are primarily substitutes for lost habitats or stepping-stones for new invaders.
Extensiv gepflegte, begrünte Dacher gelten als geeignete Habitate für einige Pflanzen und Gliedertiere, die an extrem heisse und trockene Bedingungen angepasst sind. Nur wenig ist bekannt über Spinnen, welche begrünte Dacher besiedeln. In den Jahren 2018 und 2019 wurden 29 begrünte Dacher in Basel und vier in Aarau wahrend der gesamten Vegetationsperiode mit Hilfe von Bodenfallen besammelt. Dabei wurden 18492 adulte Spinnen aus 123 Arten gesammelt. Zwei Arten wurden erstmalig fur die Schweiz nachgewiesen: Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 und Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837). Gemäss den Roten Listen für Deutschland (und speziell von Baden-Württemberg) sind aus naturschutzfachlicher Sicht 26 Arten von besonderem Interesse. Andererseits stammen vier Arten ursprünglich aus anderen Kontinenten (alien species) und 14 Arten sind in Arealerweiterung aus dem Süden nach Norden begriffen. Begrünte Dacher konnen also bedrohten Arten einen Lebensraum bieten, aber gleichzeitig besteht auch die Gefahr, dass neu eindringende Arten dominant werden (invasive Arten). Erst nach langjähriger Beobachtung wird es moglich sein, zu beurteilen, ob begrünte Dacher vor allem Ersatzlebensraume fur bedrohte Arten oder eher Trittsteine fur potenziell invasive Arten darstellen.
Nentwig W, Ansorg J, Bolzern A, Frick H, Ganske A-S, Hänggi A, Kropf C & Stäubli A 2022 Spinnen – Alles, was man wissen muss. Springer Verlag, Berlin. 265 S.
Nentwig W, Ansorg J, Bolzern A, Frick H, Ganske A-S, Hänggi A, Kropf C & Stäubli A 2022 All you need to know about spiders. Springer, Berlin. 245 pp.
book review
First record of Neoscona byzanthina (Araneae: Araneidae) in Romania
Erstnachweis von Neoscona byzanthina (Araneae: Araneidae) in Rumänien
Arachnida, citizen science, orb-web spider, species distribution
Abstract
This work reports the presence of Neoscona byzanthina (Pavesi, 1876) in Romania, partly based on records provided by citizen scientists. The species was found at five different locations. Further, morphological differences to the other species of the genus are summarized and some data on the ecology of this species together with an up-to-date distribution in Europe are presented. This is the third Neoscona species recorded in Romania and comparative pictures of the epigyne of all these species are provided.
Diese Arbeit berichtet über die Präsenz von Neoscona byzanthina in Rumänien, teilweise basierend auf Nachweisen erbracht durch Citizen scientists (Bürgerwissenschaftler* innen). Die Art wurde an fünf verschiedenen Orten gefunden. Außerdem werden die morphologischen Unterschiede zu den anderen Arten der Gattung zusammengefasst sowie einige Daten zur Ökologie der Art zusammen mit einer aktuellen europäischen Verbreitungskarte präsentiert. Dies ist der dritte Nachweis einer Art der Gattung Neoscona in Rumänien und für alle Arten werden diagnostische Fotos der Epigyne bereitgestellt.
First record of Minosiella intermedia (Araneae: Gnaphosidae) from Egypt
Erstnachweis von Minosiella intermedia (Araneae: Gnaphosidae) in Ägypten
distribution, North Africa, pomegranate, spider, taxonomy
Abstract
Minosiella intermedia Denis, 1958, from the family Gnaphosidae, is recorded from Egypt (Sadat City), and thereby the African continent, for the first time. The record, originating from a drip-irrigated pomegranate orchard, is based only on male specimens. It is the fourth recorded species of the genus Minosiella Dalmas, 1921 in Egypt. Diagnostic drawings and images of the copulatory organs are presented together with a depiction of the habitat.
Minosiella intermedia Denis, 1958, aus der Familie Gnaphosidae, wird zum ersten Mal aus Ägypten (Sadat City) und, infolgedessen, Afrika gemeldet. Der Nachweis aus einer tröpfchenbewässerten Granatapfelplantage basiert nur auf männlichen Exemplaren. Es stellt die vierte aus Ägypten gemeldete Art der Gattung Minosiella Dalmas, 1921 dar. Diagnostische Abbildungen und Zeichnungen der Geschlechtsorgane sowie eine Darstellung des Habitats werden präsentiert.
First record of the medically significant scorpion Leiurus abdullahbayrami (Scorpiones: Buthidae) for Lebanon
Erstnachweis des medizinisch bedeutenden Skorpions Leiurus abdullahbayrami (Scorpiones: Buthidae) für Libanon
distribution, East Bekaa, Levant region, new locality
Abstract
The first record of Leiurus abdullahbayrami Yağmur, Koç & Kunt, 2009 for Lebanon is presented, collected in the East Bekaa province. This is the second Leiurus species reported for this country. The medical importance of L. abdullahbayrami, associated with severe and fatal cases among children in Turkey and Syria, makes it highly relevant to determine its current distribution range in the Levant region.
Der Erstnachweis von Leiurus abdullahbayrami Yağmur, Koç & Kunt, 2009 für den Libanon wird aus der Ost Bekaa Provinz präsentiert. Es ist die zweite Leiurus-Art in diesem Land. Die medizinische Bedeutung von L. abdullahbayrami ist durch schwere und tödliche Fälle bei Kindern in der Türkei und Syrien begründet. Daher ist es von großer Wichtigkeit, die genaue Verbreitung der Art in der Levante zu dokumentieren.
First report of Heriaeus buffoni (Araneae: Thomisidae) from the Canary Islands
Erstnachweis von Heriaeus buffoni (Araneae: Thomisidae) für die Kanarischen Inseln
biodiversity, crab spider, distribution, Macaronesia, new record
Abstract
Heriaeus buffoni (Audouin, 1826) is reported for the first time from the Canary Islands, where it was found on Lanzarote. This also represents the first record of the genus in the archipelago. All individuals were collected with pitfall traps installed in nitrophilous synanthropic shrub vegetation near urban areas. Species identification was based on male genitalia only as females were not sampled. A map including all known records from Lanzarote, drawings of the pedipalps and photographs of living and preserved specimens are presented.
Heriaeus buffoni (Audouin, 1826) wird zum ersten Mal von den Kanarischen Inseln gemeldet, wo die Art auf Lanzarote gefunden wurde. Dieser Nachweis ist auch der erste der Gattung im Archipel. Alle Individuen wurden mithilfe von Bodenfallen gesammelt, welche in nitrophiler, strauchiger Vegetation nahe urbanen Gebieten installiert waren. Die Artidentifikation basiert nur auf männlichen Exemplaren, da keine weiblichen Tiere gefunden wurden. Es werden eine Karte, welche alle bekannten Nachweise von Lanzarote enthält, Zeichnungen der Pedipalpen sowie Bilder von lebenden und konservierten Individuen präsentiert.
Thanatus aridorum Šilhavý, 1940 from Czechia is a junior synonym of Thanatus formicinus (Clerck, 1757) (Araneae: Philodromidae)
Thanatus aridorum Šilhavý, 1940 aus Tschechien ist ein jüngeres Synonym von Thanatus formicinus (Clerck, 1757) (Araneae: Philodromidae)
new synonymy, pre-epigyne, subadult female, Thanatus
Abstract
We revised the type material of Thanatus aridorum Šilhavý, 1940, and noticed that it is a subadult female. Consideration of morphological characters of the three Thanatus species which co-occur at the type locality of T. aridorum led us to conclude that it is a junior synonym of Thanatus formicinus (Clerck, 1757), new synonymy.
Das Typenmaterial von Thanatus aridorum Šilhavý, 1940 wurde untersucht und dabei festgestellt, dass es sich um ein subadultes Weibchen handelt. Die Betrachtung der morphologischen Merkmale der drei an der Typuslokalität von T. aridorum vorkommenden Arten der Gattung Thanatus führten zu dem Ergebnis, dass es sich um ein jüngeres Synonym von Thanatus formicinus (Clerck, 1757), neues Synonym, handelt.
Distribution of the genus Anyphaena in the Western Mediterranean region, with the first record of Anyphaena alboirrorata in the Maghreb (Araneae: Anyphaenidae)
Verbreitung der Gattung Anyphaena im westlichen Mittelmeerraum, mit dem Erstnachweis von Anyphaena alboirrorata im Maghreb
Algeria, Morocco, Saharan Atlas, species range, spiders, Tunisia
Abstract
New data on the distribution of the genus Anyphaena Sundevall, 1833 in Mediterranean Europe and North Africa are given. Anyphaena alboirrorata Simon, 1878 is newly recorded in the Maghreb. The species was found in the Saharan and the Tell Atlas in Algeria, in one locality in Morocco and three localities in central north Tunisia. In addition, Anyphaena numida Simon, 1897 is presented as new to Morocco, together with a further record from Algeria and Tunisia. Supplementary material from Spain was examined and the data are also given. Anyphaena sabina is recorded for the first time in Algeria since records by Denis in 1937.
Neue Daten zur Verbreitung der Gattung Anyphaena im mediterranen Europa und Nordafrika werden präsentiert. Anyphaena alboirrorata Simon, 1878 wurde erstmals im Maghreb nachgewiesen. Die Art wurde im Sahara- und Tellatlas in Algerien, von einer Lokalität in Marokko sowie drei Lokalitäten im nördlichen Bereich von Zentraltunesien gefunden. Zusätzlich wird der Erstnachweis von Anyphaena numida Simon, 1897 für Tunesien sowie ein weiterer Nachweis aus Algerien vorgestellt. Ergänzendes Material aus Spanien wurde untersucht und wird ebenfalls präsentiert. Anyphaena sabina ist zum ersten Mal seit dem Fund von Denis im Jahr 1937 in Algerien nachgewiesen.
The Great Raft Spider Dolomedes plantarius rediscovered in Saxony (Araneae: Pisauridae)
Wiederfund der Großen Jagdspinne Dolomedes plantarius für Sachsen (Araneae: Pisauridae)
bathing lake, fish ponds, threatened species, Saxony, water management, water quality
Abstract
Dolomedes plantarius has been rediscovered in Saxony (Germany) for the first time since its only previous finding in 1948. The new discoveries were made between 1996 and 2021 in northern Upper Lusatia by sweep netting in the marginal, emergent and floating vegetation around an extensively used swimming lake and three fish ponds. All ponds where the species was recorded are located in areas with several still-water bodies and are characterised by a structurally rich marginal or floating vegetation. The water bodies showed a high nutrient content and the swimming lake had a very low pH. As part of their management, the fish ponds are regularly drained in autumn. We suppose that after the ponds are refilled in spring D. plantarius recolonises from neighbouring ponds that retained their water.
Nach dem ersten und einzigen Fund im Jahr 1948 wurde Dolomedes plantarius zwischen 1996 und 2021 wiederholt in der nördlichen Oberlausitz (Sachsen) gefunden. Die Zufallsfunde gelangen in der Ufervegetation beziehungsweise dem Schwimmblattgürtel eines extensiv genutzten Badesees und von drei Fischteichen mit Hilfe von Kescherfängen. Alle Teiche, in denen die Art nachgewiesen werden konnte, liegen in Gebieten mit mehreren Stillgewässern und zeichnen sich durch eine strukturreiche Ufer- oder Schwimmblattvegetation aus. Die Gewässer wiesen einen hohen Nährstoffgehalt auf, der Badesee einen sehr niedrigen pH-Wert. Die Fischteiche werden im Rahmen der Bewirtschaftung regelmäßig im Herbst abgelassen. Es ist anzunehmen, dass D. plantarius die Teiche nach der Bespannung im Frühjahr von benachbarten, wasserführenden Teichen wiederbesiedelt.
New data on pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) in north-east Slovakia
Neue Daten über Pseudoskorpione (Arachnida: Pseudoscorpiones) im Nordosten der Slowakei
Carpathians, distribution, faunistic, forest leaf litter
Abstract
The present paper presents new data on the diversity and distribution of pseudoscorpions from seven localities in the Stebnicka Magura massif in the Low Beskids, two localities in the East Carpathians Protected Landscape Area (PLA) and one locality in the Vihorlat PLA, Slovakia, collected by sieving methods. Altogether, 372 pseudoscorpion specimens belonging to 15 species and four families were sampled over three years (2007, 2010, 2015). The most abundant families were Neobisiidae (335 specimens, nine taxa) and Chthoniidae (33 specimens, four taxa); while the families Cheiridiidae and Chernetidae were represented by only one species each. Neobisium sylvaticum (C. L. Koch, 1835), Neobisium erythrodactylum (L. Koch, 1873), Ephippiochthonius boldorii (Beier, 1934), Ephippiochthonius tetrachelatus Preyssler, 1790 and Roncus sp. were recorded only in the East Carpathians PLA within our study. The most abundant species was Neobisium crassifemoratum (Beier, 1928). The species Ephippiochthonius boldorii and Ephippiochthonius fuscimanus (Simon, 1900) were found in this area for the first time.
Die vorliegende Arbeit enthalt neue Daten über die Diversitat und Verbreitung von Pseudoskorpionen aus sieben Fundorten in Stebnicka Magura in den Niederen Beskiden, zwei Fundorten im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Ostkarpaten und einem Fundort in Vihorlat LSG, Slowakei, gesammelte mit der Siebmethode. Insgesamt 372 Pseudoskorpion-Exemplare, die zu 15 Arten und vier Familien gehoren, wurden in drei einjährigen Saisons (2007, 2010, 2015) identifiziert. Am häufigsten waren die Familien Neobisiidae (335 Exemplare, neun Taxa) und Chthoniidae (33 Exemplare, vier Taxa); die Familien Cheiridiidae und Chernetidae waren jeweils nur mit einer Art vertreten. Neobisium sylvaticum (C. L. Koch, 1835), Neobisium erythrodactylum (L. Koch, 1873), Ephippiochthonius boldorii (Beier, 1934), Ephippiochthonius tetrachelatus Preyssler, 1790 und Roncus sp. wurden nur im Landschaftsschutzgebiet Ostkarpaten erfasst. Die zahlreichste Art in der gesamten Untersuchung war Neobisium crassifemoratum (Beier, 1928). Bemerkenswert sind die Nachweise von Ephippiochthonius boldorii und Ephippiochthonius fuscimanus (Simon, 1900), die erstmals in dieser Region gefunden wurden.
Larinia chloris and Uroctea thaleri represent new records of two genera for Iraq (Araneae: Araneidae, Oecobiidae)
Larinia chloris und Uroctea thaleri sind zwei neue Gattungsnachweise für den Irak (Araneae: Araneidae, Oecobiidae)
distribution, Middle East, spider, taxonomy
Abstract
Female specimens of the genera Larinia Simon, 1874 (Araneidae) and Uroctea Dufour, 1820 (Oecobiidae) are reported from southern Iraq, representing the first records of both these genera for the Iraqi spider fauna. The specimens were identified as Larinia chloris (Audouin, 1826) and Uroctea thaleri Rheims, Santos & van Harten, 2007. The first species was found near water, corroborating observations in the literature that it prefers riparian habitats. The characteristic features of the species are described and figured and illustrations of the habitat are presented.
Weibliche Individuen der Gattung Larinia Simon, 1874 (Araneidae) und Uroctea Dufour, 1820 (Oecobiidae) werden aus dem südlichen Irak präsentiert und stellen die Erstnachweise der beiden Gattungen für den Irak dar. Die Individuen wurden als Larinia chloris (Audouin, 1826) und Uroctea thaleri Rheims, Santos & van Harten, 2007 identifiziert. Die charakteristischen Merkmale der Arten werden beschrieben und illustriert sowie Bilder des Habitats gezeigt.